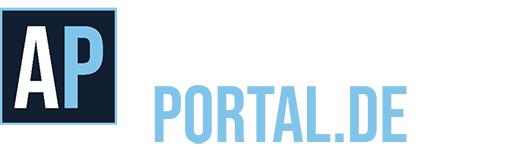Wer krank ist, muss dem Arbeitgeber rechtzeitig eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen – sonst drohen Abmahnung oder Lohnkürzung. Dieser Beitrag erklärt, ab wann die Nachweispflicht gilt, welche Fristen und Formen zu beachten sind und welche Besonderheiten für Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften relevant sind. Mit praxisnahen Tipps, um Konflikte zu vermeiden und Rechte zu sichern.
Inhaltsverzeichnis
1. Was bedeutet Nachweispflicht bei Arbeitsunfähigkeit?
Die Nachweispflicht verpflichtet Arbeitnehmer, ihrem Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, wenn sie krankheitsbedingt nicht arbeiten können. Diese Bescheinigung wird umgangssprachlich oft „Krankschreibung“ genannt, im Gesetz heißt sie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU).
Sie dient dem Arbeitgeber als Nachweis, dass die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich vorliegt, und ist Voraussetzung für die Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Für Betriebsräte und Gewerkschaften ist die Kenntnis dieser Pflicht wichtig, um Arbeitnehmer bei der korrekten Erfüllung zu unterstützen und unnötige arbeitsrechtliche Probleme zu vermeiden.
2. Rechtliche Grundlagen der Nachweispflicht
Die Nachweispflicht ist in § 5 EFZG geregelt. Dort steht, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Außerdem muss spätestens am vierten Kalendertag der Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung vorliegen – es sei denn, der Arbeitgeber verlangt sie früher.
a) Unverzügliche Krankmeldung
„Unverzüglich“ bedeutet ohne schuldhaftes Zögern – in der Praxis meist am ersten Krankheitstag, bevor die Arbeit beginnt. Die Meldung kann telefonisch, per E-Mail oder – wenn üblich – über ein internes Meldesystem erfolgen. Vorsicht! Existieren Meldungsrichtlinien oder Anordnung bei Ihrem Arbeitgeber, müssen Sie sich an diese halten! Sonst drohen Abmahnungen.
b) Vorlagefrist der AU-Bescheinigung
Grundsätzlich muss die AU spätestens am vierten Tag vorliegen. Fällt der vierte Tag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, reicht es, wenn die Bescheinigung am nächsten Arbeitstag eingeht. Arbeitgeber können aber durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Weisung verlangen, dass die AU schon ab dem ersten Krankheitstag vorgelegt wird.
c) Elektronische AU (eAU)
Seit 2023 übermitteln Arztpraxen die AU-Daten elektronisch an die Krankenkassen, und Arbeitgeber rufen diese dort ab. Arbeitnehmer müssen aber trotzdem die Krankmeldung wie bisher vornehmen und sicherstellen, dass der Arzt die Daten korrekt übermittelt.
3. Wann darf der Arbeitgeber die AU früher verlangen?
Der Arbeitgeber darf ohne besonderen Grund eine AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag fordern. Arbeitnehmer sollten diese Pflicht kennen und im Zweifelsfall direkt am ersten Krankheitstag zum Arzt gehen, um Abmahnungen oder Lohnkürzungen zu vermeiden.
a) Vertragliche Regelungen
Viele Arbeitsverträge enthalten Klauseln zur Vorlage der AU-Bescheinigung. Wer unterschreibt, akzeptiert diese Fristen.
b) Betriebliche Übung und Betriebsvereinbarung
In manchen Betrieben hat sich eine Praxis entwickelt, die AU immer ab dem ersten Tag vorzulegen – auch ohne schriftliche Regelung. Betriebsräte können hier auf klar geregelte und faire Fristen hinwirken.
4. Folgen bei Verstoß gegen die Nachweispflicht
Wer die Nachweispflicht verletzt, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen.
a) Abmahnung
Eine verspätete Krankmeldung oder das verspätete Einreichen der AU kann zur Abmahnung führen. Wiederholte Verstöße können eine Kündigung rechtfertigen.
b) Entgeltfortzahlung
Liegt keine AU vor, kann der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung verweigern, bis der Nachweis erbracht ist.
c) Verdacht auf Missbrauch
Unklare oder verspätete Krankmeldungen können Misstrauen wecken und zu weiteren arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen – bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
5. Rechte von Arbeitnehmern, Betriebsräten und Gewerkschaften
Arbeitnehmer haben Anspruch darauf, dass ihre Krankmeldungen vertraulich behandelt werden – Details zur Krankheit müssen nicht mitgeteilt werden. Nur die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist anzugeben.
a) Betriebsrat
Der Betriebsrat hat kein Recht auf Einsicht in medizinische Diagnosen, kann aber auf faire und klare Regelungen zur Nachweispflicht im Betrieb hinwirken.
b) Gewerkschaften
Gewerkschaften beraten Mitglieder bei Streitigkeiten um Lohnfortzahlung und vertreten sie vor Gericht, falls der Arbeitgeber die AU nicht anerkennt.
c) Beweiswert der AU
Die AU gilt grundsätzlich als starker Beweis für eine tatsächliche Erkrankung. Arbeitgeber können diesen Beweis nur erschüttern, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Missbrauch vorliegen.
6. Praxis-Tipps zur Erfüllung der Nachweispflicht
- Krankheit sofort beim Arbeitgeber melden, am besten schriftlich oder nachweisbar.
- AU-Bescheinigung rechtzeitig anfordern, besonders wenn vertraglich der erste Krankheitstag zählt.
- Bei längerer Krankheit Folgebescheinigungen lückenlos einreichen.
- Bei Problemen frühzeitig Betriebsrat oder Gewerkschaft einschalten.
7. Fazit und Handlungsempfehlung
Die Nachweispflicht bei Arbeitsunfähigkeit ist klar geregelt und lässt wenig Spielraum: Arbeitnehmer müssen ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich melden und die AU fristgerecht einreichen. Arbeitgeber dürfen die Vorlage ab dem ersten Krankheitstag verlangen. Wer diese Regeln beachtet, vermeidet Konflikte und sichert seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten sollten Arbeitnehmer nicht zögern, sich an einen Anwalt für Arbeitsrecht zu wenden.
Bitte beachten Sie: Unsere Beiträge dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen in keinem Fall eine Rechtsberatung dar, die insbesondere auf der Grundlage Ihres individuellen Sachverhalts ersetzt werden kann. Außerdem kann sich die aktuelle Rechtslage durch aktuelle Urteile und Gesetze zwischenzeitlich geändert haben. Wenn Sie eine rechtssichere und individuelle Rechtsberatung wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
Sie suchen kompetente anwaltliche Unterstützung? Wir stehen Ihnen zur Seite – zuverlässig, zielorientiert und engagiert. Ob Beratung, Verhandlung oder Vertretung: Wir setzen uns für Ihre Rechte ein. Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Anliegen klären!
Telefon: 0151 / 725 429 77
E-Mail: info@arbeitsrecht-portal.de