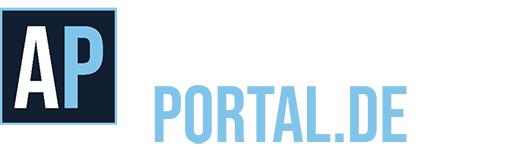Gleichgestellte im Arbeitsrecht erhalten fast den gleichen Schutz wie Schwerbehinderte – aber ohne Zusatzurlaub. Dieser Leitfaden erklärt Voraussetzungen, Antrag, Kündigungsschutz und Rechte aus SGB IX mit Bezügen zu GewO und BGB. Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften erfahren, wie Gleichstellung Beschäftigung sichert und was unbedingt zu beachten ist. Mit Checkliste für die Praxis und klaren Hinweisen zu Zuständigkeiten und Fristen.
Inhaltsverzeichnis
1. Gleichgestellte: Was bedeutet das und für wen gilt es?
„Gleichgestellte“ sind Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 30 oder 40, die auf Antrag bei der Agentur für Arbeit den rechtlichen Status erhalten, schwerbehinderten Menschen gleichgestellt zu werden. Das dient dem Ziel, einen geeigneten Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten, wenn dies ohne Gleichstellung gefährdet wäre. Die Gleichstellung wirkt nach der Entscheidung rückwirkend ab Antragseingang, was in der Praxis wichtig ist, etwa bei drohenden Kündigungen. Zuständig ist die Agentur für Arbeit; sie hört regelmäßig auch Arbeitgeber und die Schwerbehindertenvertretung an.
a) Kernelemente der Anspruchsvoraussetzungen
Voraussetzung ist ein GdB von mindestens 30, aber unter 50, plus die konkrete Gefahr, dass ohne Gleichstellung der Arbeitsplatz nicht erlangt oder nicht gesichert werden kann. Reine Zweckmäßigkeit genügt nicht – erforderlich ist eine nachvollziehbare Begründung, warum gerade der besonders geregelte Schutz benötigt wird. Typische Nachweise sind ärztliche Atteste, eine aktuelle Arbeitsplatzbeschreibung sowie eine kurze betriebliche Stellungnahme. Für Betriebsräte und Gewerkschaften empfiehlt sich, die Begründung strukturiert aufzubereiten und frühzeitig Kontakt zur Agentur aufzunehmen.
2. Rechte Gleichgestellter nach SGB IX – Übersicht
Mit der Gleichstellung greifen im Wesentlichen die Schutzmechanismen des Teils 3 SGB IX (Schwerbehindertenrecht). Dazu zählen vor allem der besondere Kündigungsschutz, Ansprüche auf behinderungsgerechte Beschäftigung und Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung (SBV).
a) Kündigungsschutz und Integrationsamt
Grundsätzlich darf eine Kündigung gegenüber Schwerbehinderten und Gleichgestellten nur mit vorheriger Zustimmung des Integrations- bzw. Inklusionsamtes ausgesprochen werden (§ 168 SGB IX). Eine zentrale Ausnahme gilt in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses (Wartezeit): In dieser Phase ist die Zustimmung in der Regel nicht erforderlich (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX). Praktisch bedeutet das: Nach sechs Monaten greift der volle besondere Kündigungsschutz, zusätzlich zur allgemeinen Prüfung nach dem KSchG.
b) Mindestkündigungsfrist
Sobald der besondere Kündigungsschutz greift, beträgt die Mindestkündigungsfrist gegenüber schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten vier Wochen (§ 169 SGB IX). Diese Frist ist einseitig zwingend zugunsten der Betroffenen; kürzere vertragliche oder tarifliche Fristen sind dann unwirksam. In der Wartezeit des § 173 SGB IX gilt diese Mindestfrist allerdings noch nicht.
c) Behinderungsgerechte Beschäftigung und Nachteilsausgleich im Betrieb
Arbeitgeber haben die Pflicht, Arbeitsplätze behinderungsgerecht zu gestalten und Benachteiligungen zu vermeiden (§ 164 SGB IX, sog. leidensgerechter Arbeitsplatz). Dazu zählen zum Beispiel technische Hilfen, angepasste Arbeitszeiten, geänderte Aufgabenzuschnitte oder Fortbildungsangebote – jeweils soweit zumutbar. Für Betriebsräte und Gewerkschaften ist § 164 SGB IX die zentrale Norm, um im Betrieb konkrete Anpassungen einzufordern und Lösungen mit dem Arbeitgeber zu verhandeln.
d) Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung (SBV)
Vor jeder Kündigung ist die SBV zwingend zu beteiligen – eine ohne SBV-Beteiligung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam (§ 178 Abs. 2 SGB IX). Das hat das Bundesarbeitsgericht präzisiert: Entscheidend ist, dass die SBV vor Ausspruch der Kündigung ordnungsgemäß unterrichtet und angehört wurde; zur genauen Reihenfolge im Verhältnis zu Betriebsrat und Integrationsamt gibt es Spielraum, solange die SBV rechtzeitig beteiligt ist. Das gilt auch in der Wartezeit, obwohl dort das Integrationsamt oft noch nicht zustimmen muss.
3. Antragstellung: So gehen Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften vor
Der Antrag auf Gleichstellung wird bei der Agentur für Arbeit gestellt – schriftlich oder online. Wichtig ist ein präziser Sachverhalt: Welche Tätigkeiten fallen schwer? Wo droht der Arbeitsplatzverlust? Welche Anpassungen wären geeignet? Je konkreter, desto höher die Erfolgsaussichten. Praktisch hilfreich ist es, die betriebliche Interessenvertretung einzubinden und die Begründung gemeinsam zu formulieren.
a) Nachweise und Formulierungstipps
Fügen Sie aktuelle medizinische Unterlagen, den GdB-Bescheid und eine Arbeitsplatzbeschreibung bei. Empfehlenswert ist eine strukturierte Begründung mit drei Bausteinen: (1) gesundheitliche Einschränkungen, (2) konkrete arbeitsplatzbezogene Auswirkungen, (3) Risiko für Arbeitsplatz/Jobsuche ohne Gleichstellung. Betriebsräte können eine kurze Stellungnahme beifügen; Gewerkschaften unterstützen oft mit Mustertexten und Erfahrung aus Parallelfällen. Das erhöht die Plausibilität und spart Nachfragen.
b) Wirkung ab Antrag und Eilverfahren
Die Gleichstellung entfaltet Wirkung ab dem Tag des Antragseingangs (Rückwirkung), sobald die Agentur positiv entscheidet. In dringenden Fällen (z. B. angekündigte Kündigung) lohnt sich der Hinweis auf die Eilbedürftigkeit; in der Praxis kann dies die Bearbeitung beschleunigen. Dokumentieren Sie den genauen Eingangstag – E-Mail-/Online-Bestätigung oder Eingangsvermerk – und bewahren Sie die Nachweise auf.
c) Typische Fehler und wie man sie vermeidet
Häufig scheitern Anträge, weil der Gefährdungstatbestand („ohne Gleichstellung Arbeitsplatzverlust“) nicht konkret belegt ist. Vermeiden Sie pauschale Aussagen; nennen Sie klar erkennbare Risiken (z. B. Leistungsdruck, Schichtanforderungen, fehlende Hilfsmittel). Ein weiterer Fehler ist, Zusatzurlaub zu beantragen – der steht Gleichgestellten nicht zu und schwächt den Antrag. Achten Sie außerdem darauf, betriebliche Alternativen (Umsetzung, technische Hilfen) zu erwähnen, die mit Gleichstellung rechtssicher flankiert werden sollen.
4. Bezüge zu GewO und BGB: Was Arbeitgeber beachten müssen
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers (§ 106 GewO) gilt auch gegenüber Gleichgestellten, ist aber durch die Rücksichtnahmepflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) und § 164 SGB IX begrenzt. Weist der Arbeitgeber Tätigkeiten zu, muss er gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigen und zumutbare Anpassungen prüfen. Bei Versetzungen und Arbeitszeitmodellen ist eine einzelfallbezogene Abwägung erforderlich; starre Standards verbieten sich. Für Betriebsräte ergibt sich daraus ein starker Hebel, auf arbeitsplatzbezogene Lösungen zu drängen – im Zweifel mit Verweis auf § 164 SGB IX.
a) Verhältnis zum allgemeinen Kündigungsschutz (KSchG)
Der besondere Kündigungsschutz aus §§ 168 ff. SGB IX ist vorgeschaltet und unabhängig von Schwellenwerten des KSchG. Ist das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden, braucht der Arbeitgeber vor einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung regelmäßig die Zustimmung des Integrationsamtes; danach folgt erst die arbeitsgerichtliche Prüfung (soziale Rechtfertigung, Interessenabwägung). In der Wartezeit entfällt das Zustimmungserfordernis; die SBV-Beteiligung bleibt dennoch Pflicht.
b) Beschäftigungspflicht und Anrechnung im Betrieb
Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen im Jahresdurchschnitt 5 % Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen besetzen (§ 154 SGB IX). Gleichgestellte zählen hierfür mit; in besonderen Konstellationen kann die Agentur für Arbeit sogar eine Mehrfachanrechnung zulassen. Das ist für Betriebsräte und Gewerkschaften relevant, um betriebliche Inklusionsziele zu erreichen und Ausgleichsabgaben zu vermeiden.
5. Abgrenzung: Kein Zusatzurlaub für Gleichgestellte
Wichtig für die Praxis: Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX erhalten ausschließlich Schwerbehinderte. Gleichgestellte haben keinen gesetzlichen Anspruch hierauf – auch nicht anteilig. Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen können zwar günstigere Regelungen für Schwerbehinderte vorsehen, gelten aber nicht automatisch für Gleichgestellte. Diese klare Abgrenzung verhindert falsche Erwartungshaltungen und vermeidet spätere Streitigkeiten.
6. Praxis-Checkliste für Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften
Prüfen Sie zuerst den GdB-Bescheid (30/40) und skizzieren Sie die konkreten arbeitsplatzbezogenen Einschränkungen. Erstellen Sie eine Begründungsmatrix: Tätigkeit – Einschränkung – benötigte Anpassung – Risiko ohne Gleichstellung. Reichen Sie den Antrag zeitnah bei der Agentur für Arbeit ein und dokumentieren Sie den Eingang. Bei drohender Kündigung: SBV sofort einbeziehen, Beteiligung sicherstellen und – nach sechs Monaten Beschäftigung – auf das Zustimmungserfordernis hinweisen; ansonsten zumindest auf ordnungsgemäße SBV-Anhörung achten.
7. Fazit und Handlungsempfehlung
Die Gleichstellung im Sinne des SGB IX ist ein starkes Instrument zur Sicherung von Beschäftigung, insbesondere bei gesundheitlichen Einschränkungen. Für Gleichgestellte gelten Kernrechte wie besonderer Kündigungsschutz (nach sechs Monaten), behinderungsgerechte Beschäftigung und SBV-Beteiligung – ohne Anspruch auf Zusatzurlaub. Damit Rechte im Einzelfall richtig greifen, kommt es auf saubere Antragstellung, klare Dokumentation und die korrekte Beteiligung der Gremien an. Holen Sie im Zweifel frühzeitig rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Arbeitsrecht ein – besonders bei drohenden Kündigungen, Umsetzungen oder Streit über Anpassungen am Arbeitsplatz.
Bitte beachten Sie: Unsere Beiträge dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen in keinem Fall eine Rechtsberatung dar, die insbesondere auf der Grundlage Ihres individuellen Sachverhalts ersetzt werden kann. Außerdem kann sich die aktuelle Rechtslage durch aktuelle Urteile und Gesetze zwischenzeitlich geändert haben. Wenn Sie eine rechtssichere und individuelle Rechtsberatung wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
Sie suchen kompetente anwaltliche Unterstützung? Wir stehen Ihnen zur Seite – zuverlässig, zielorientiert und engagiert. Ob Beratung, Verhandlung oder Vertretung: Wir setzen uns für Ihre Rechte ein. Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Anliegen klären!
Telefon: 0151 / 725 429 77
E-Mail: info@arbeitsrecht-portal.de